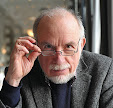Wer sich abartig benimmt oder sich gefährdet kommt ins Irrenhaus. Die Insassen sagen dem Spinnwinde. Wer stiehlt, vergewaltigt oder mordet kommt ins Gefängnis oder ins Zuchthaus. Dem sagen sie Knast oder Kiste.
Wer lange in der Kiste war muss erneut lernen, sich in Freiheit zu bewegen, mit Geld umzugehen oder mit der Strassenbahn zu fahren. Und nach Jahren in Sträflingskleidung braucht er Zivilkleider. Vier Wochen vor der Entlassung verlegt man ihn deshalb vom Knast in die Spinnwinde. In die offene Abteilung natürlich. Er kann an Beschäftigungstherapien teilnehmen, oder halbtags ein- und ausgehen, wie er will.
Krank sind die nicht und die Strafe haben sie verbüsst. Als junger Assistenzarzt in diesem Irrenhaus hatte ich eigentlich nicht viel mit ihnen zu tun. Immerhin, in einer medizinischen Institution gibt es Rituale - Ordnung muss sein: Der Arzt muss begrüssen, er studiert Gerichtsurteil, Führungsberichte und Akten, er macht ein ausführliches Aufnahmegespräch, pro forma auch eine körperliche Untersuchung. Und täglich Arztvisite.
Um zu zeigen, wie das so geht können wir den Fall von Rüegsegger nehmen: Ein gutaussehender, sauber rasierter Mittvierziger mit markantem Gesicht, sonnengebräunt und muskulös. Typus bäuerlicher Heimatfilm. Für einen Mann eigentlich das beste Alter. Bei der Begrüssung eine raumfüllende Ausstrahlung, durchaus einnehmend. Ein Händedruck wie ein Schraubstock. "Schön, Sie kennenzulernen Herr Doktor". "Jawoll, es ist gut hier Herr Doktor", "Ich sehe das positiv Herr Doktor"... Rüegsegger arbeitet in der Gartengruppe. Wenn man dort vorbeikommt ertönt sein markiges "Tag Herr Doktor". Der Aufseher der Gartengruppe berichtet, dieser Mann könne wirklich anpacken. Der sei tüchtiger als drei andere zusammen. Und was für eine positive Einstellung. Tatsächlich, wenn man ihn fürs Gespräch oder die Untersuchung bittet kommt sofort das markig-metallische "Jawoll Herr Doktor, machen wir gern Herr Doktor". Das muss man dem Knast lassen, die lernen gehorchen.
In den Akten hervorragender Führungsbericht. Nicht die geringsten Probleme im Zuchthaus. Eine voll positive Entwicklung. Da habe einer seinen Weg gefunden schreibt der Direktor.
Der Rüegsegger war ein Berufsmann, hatte Schreiner oder Elektriker gelernt, ich erinnere das nicht mehr genau. Jedenfalls positiv, kein Versager. Machte auch Militärdienst bei der Infanterie.
Der nächste Lebensschritt war die Heirat. Und Rüegsegger heiratete mit 23 Jahren, wie es sich gehört. Nur, irgendwie war das jetzt nicht so positiv. Die gute Frau nervte, es gab Auseinandersetzungen. Und nach drei Jahren nahm Rüegsegger seinen militärischen Karabiner und erschoss die Frau.
Das Gericht beugte sich über den Fall. Heftige Gemütsbewegung schien vorgelegen zu haben. Planung oder Vorbereitung waren nicht greifbar. Man erkannte auf Totschlag. Der Mann war ja sonst positiv. Er sollte seine Chance haben: Drei Jahre Gefängnis. Dort vorbildliche Führung und Einstellung, packte überall an, Jawoll Herr Doktor. Er konnte nach zwei Jahren vorzeitig entlassen werden. Da war er 28.
Mit Dreissig war er das zweite Mal verheiratet. Die Frau nervte. Es gab Auseinandersetzungen. Und nach zwei Jahren beschaffte Rüegsegger eine Schusswaffe... Das war Mord. Kein mildernder Umstand. Der Mann erhielt die Höchststrafe: 20 Jahre Zuchthaus.
Bei guter Führung kann man nach zwei Dritteln der Strafe entlassen werden, Dem stand nichts entgegen. So war er jetzt bei uns, der gutaussehende, braungebrannte, positive Mittvierziger. Jawoll Herr Doktor.
Eigentlich mochte ich den Typen und seine unbekümmert positive Einstellung, im Stil von "wir schaffen das". Da war keine Bosheit, keine Perversion, kein Sadismus. Man konnte ihn gar nicht hassen. Der konnte doch nichts dafür. Bei dem musste wohl eine Schraube locker sein. Wie viel einfacher wäre es gewesen, sich von den nervigen Frauen zu trennen, ohne jahrelanges Vegetieren im Zuchthaus. Was für eine Dummheit, Schusswaffen einzusetzen.
Aber, wenn man an seine Entlassung dachte wurde einem schon mulmig. In ein, zwei Jahren würde er wieder eine Frau finden. Und dann? Das liess mir keine Ruhe. Als junger Arzt gehst Du zum Oberarzt und hoffst auf Rat.
Oberarzt auf der Männerseite war Dr.C., ein beleibter, desillusionierter Fünfziger, der nur selten auf den Abteilungen zu sehen war. Aber als resignierter Altlinker konnte er mit den militant-gewerkschaftlich organisierten Pflegern kutschieren. Eine Symbiose, die nicht jedem gegeben war. Ihm schilderte ich den Fall und mein Missbehagen.
Hinter der randlosen Brille erglomm ein Funke milden Interesses, vielleicht sogar ein Funke früherer linker Ideale: Das komme vom Schuldstrafrecht meinte er mit wegwerfender Geste. Das Bemessen einer Schuld sei wissenschaftlich unmöglich. Und dieser nicht messbaren Schuld eine Strafe zuzumessen sei Hochstapelei. Gescheiter wäre es, die Schuld auszuklammern und den Mann gemäss seinem Gefährdungspotential aus dem Verkehr zu ziehen. Einen Tiger strafe man ja auch nicht, man gebe ihm ein schönes Gehege. Aber weil die Rechten auf Law and Order durch Strafen pochten werde man so einem Fall nicht gerecht.
Bald darauf kam Rüegsegger frei. Sicher hat er wieder eine Partnerin gefunden. Wie es ihr ergangen ist entzieht sich meiner Kenntnis.
Jawoll, Herr Doktor.
____________________________________________________
Zwei weitere Betrachtungen zum gleichen Thema:
Wer lange in der Kiste war muss erneut lernen, sich in Freiheit zu bewegen, mit Geld umzugehen oder mit der Strassenbahn zu fahren. Und nach Jahren in Sträflingskleidung braucht er Zivilkleider. Vier Wochen vor der Entlassung verlegt man ihn deshalb vom Knast in die Spinnwinde. In die offene Abteilung natürlich. Er kann an Beschäftigungstherapien teilnehmen, oder halbtags ein- und ausgehen, wie er will.
Krank sind die nicht und die Strafe haben sie verbüsst. Als junger Assistenzarzt in diesem Irrenhaus hatte ich eigentlich nicht viel mit ihnen zu tun. Immerhin, in einer medizinischen Institution gibt es Rituale - Ordnung muss sein: Der Arzt muss begrüssen, er studiert Gerichtsurteil, Führungsberichte und Akten, er macht ein ausführliches Aufnahmegespräch, pro forma auch eine körperliche Untersuchung. Und täglich Arztvisite.
Um zu zeigen, wie das so geht können wir den Fall von Rüegsegger nehmen: Ein gutaussehender, sauber rasierter Mittvierziger mit markantem Gesicht, sonnengebräunt und muskulös. Typus bäuerlicher Heimatfilm. Für einen Mann eigentlich das beste Alter. Bei der Begrüssung eine raumfüllende Ausstrahlung, durchaus einnehmend. Ein Händedruck wie ein Schraubstock. "Schön, Sie kennenzulernen Herr Doktor". "Jawoll, es ist gut hier Herr Doktor", "Ich sehe das positiv Herr Doktor"... Rüegsegger arbeitet in der Gartengruppe. Wenn man dort vorbeikommt ertönt sein markiges "Tag Herr Doktor". Der Aufseher der Gartengruppe berichtet, dieser Mann könne wirklich anpacken. Der sei tüchtiger als drei andere zusammen. Und was für eine positive Einstellung. Tatsächlich, wenn man ihn fürs Gespräch oder die Untersuchung bittet kommt sofort das markig-metallische "Jawoll Herr Doktor, machen wir gern Herr Doktor". Das muss man dem Knast lassen, die lernen gehorchen.
 |
| Die psychiatrische Klinik, wo sich das abgespielt hat. |
In den Akten hervorragender Führungsbericht. Nicht die geringsten Probleme im Zuchthaus. Eine voll positive Entwicklung. Da habe einer seinen Weg gefunden schreibt der Direktor.
Der Rüegsegger war ein Berufsmann, hatte Schreiner oder Elektriker gelernt, ich erinnere das nicht mehr genau. Jedenfalls positiv, kein Versager. Machte auch Militärdienst bei der Infanterie.
Der nächste Lebensschritt war die Heirat. Und Rüegsegger heiratete mit 23 Jahren, wie es sich gehört. Nur, irgendwie war das jetzt nicht so positiv. Die gute Frau nervte, es gab Auseinandersetzungen. Und nach drei Jahren nahm Rüegsegger seinen militärischen Karabiner und erschoss die Frau.
Das Gericht beugte sich über den Fall. Heftige Gemütsbewegung schien vorgelegen zu haben. Planung oder Vorbereitung waren nicht greifbar. Man erkannte auf Totschlag. Der Mann war ja sonst positiv. Er sollte seine Chance haben: Drei Jahre Gefängnis. Dort vorbildliche Führung und Einstellung, packte überall an, Jawoll Herr Doktor. Er konnte nach zwei Jahren vorzeitig entlassen werden. Da war er 28.
Mit Dreissig war er das zweite Mal verheiratet. Die Frau nervte. Es gab Auseinandersetzungen. Und nach zwei Jahren beschaffte Rüegsegger eine Schusswaffe... Das war Mord. Kein mildernder Umstand. Der Mann erhielt die Höchststrafe: 20 Jahre Zuchthaus.
Bei guter Führung kann man nach zwei Dritteln der Strafe entlassen werden, Dem stand nichts entgegen. So war er jetzt bei uns, der gutaussehende, braungebrannte, positive Mittvierziger. Jawoll Herr Doktor.
Eigentlich mochte ich den Typen und seine unbekümmert positive Einstellung, im Stil von "wir schaffen das". Da war keine Bosheit, keine Perversion, kein Sadismus. Man konnte ihn gar nicht hassen. Der konnte doch nichts dafür. Bei dem musste wohl eine Schraube locker sein. Wie viel einfacher wäre es gewesen, sich von den nervigen Frauen zu trennen, ohne jahrelanges Vegetieren im Zuchthaus. Was für eine Dummheit, Schusswaffen einzusetzen.
Aber, wenn man an seine Entlassung dachte wurde einem schon mulmig. In ein, zwei Jahren würde er wieder eine Frau finden. Und dann? Das liess mir keine Ruhe. Als junger Arzt gehst Du zum Oberarzt und hoffst auf Rat.
Oberarzt auf der Männerseite war Dr.C., ein beleibter, desillusionierter Fünfziger, der nur selten auf den Abteilungen zu sehen war. Aber als resignierter Altlinker konnte er mit den militant-gewerkschaftlich organisierten Pflegern kutschieren. Eine Symbiose, die nicht jedem gegeben war. Ihm schilderte ich den Fall und mein Missbehagen.
Hinter der randlosen Brille erglomm ein Funke milden Interesses, vielleicht sogar ein Funke früherer linker Ideale: Das komme vom Schuldstrafrecht meinte er mit wegwerfender Geste. Das Bemessen einer Schuld sei wissenschaftlich unmöglich. Und dieser nicht messbaren Schuld eine Strafe zuzumessen sei Hochstapelei. Gescheiter wäre es, die Schuld auszuklammern und den Mann gemäss seinem Gefährdungspotential aus dem Verkehr zu ziehen. Einen Tiger strafe man ja auch nicht, man gebe ihm ein schönes Gehege. Aber weil die Rechten auf Law and Order durch Strafen pochten werde man so einem Fall nicht gerecht.
Bald darauf kam Rüegsegger frei. Sicher hat er wieder eine Partnerin gefunden. Wie es ihr ergangen ist entzieht sich meiner Kenntnis.
Jawoll, Herr Doktor.
____________________________________________________
Zwei weitere Betrachtungen zum gleichen Thema: